Brandschutz im Schulbau:
Wenn Sicherheit zu hoch hängt

Wer die Nutzer*innen vergisst, riskiert mehr als Sicherheit
In mehreren Grundschulen habe ich beobachtet, dass Feuerlöscher so hoch angebracht waren, dass Kinder sie nicht erreichen konnten. Eine Kleinigkeit? Im Gegenteil: Dieses Beispiel zeigt, wie Sicherheitsaspekte zwar normgerecht umgesetzt werden – aber an der Lebensrealität der Kinder vorbeigehen.
Brandschutz darf im Schulbau nicht nur als technische Disziplin betrachtet werden. Er muss integraler Bestandteil der Architektur und Schulentwicklung sein – mitgedacht vom ersten Entwurf bis zum pädagogischen Alltag. Denn Sicherheit ist nicht nur eine bauliche, sondern auch eine soziale Frage: Wie schnell können Kinder im Notfall reagieren? Sind Fluchtwege intuitiv auffindbar? Und wie werden alle Nutzer*innen einbezogen – auch die, die nicht schnell rennen oder Anweisungen sofort verstehen können?
Dieser Beitrag beleuchtet, worauf es beim Brandschutz im Schulbau ankommt – fachlich, organisatorisch und konzeptionell. Er zeigt typische Herausforderungen und bietet Orientierung für alle, die verantwortlich planen und bauen.
1. Mehr als Vorschrift: Warum Brandschutz in Schulen besonders ernst genommen werden muss
Schulgebäude sind keine gewöhnlichen Zweckbauten. Sie sind Lebens- und Lernorte für Kinder und Jugendliche – viele davon besonders schutzbedürftig. Die hohe Zahl gleichzeitiger Nutzer*innen, heterogene Altersgruppen und eingeschränkte Mobilität einzelner Personen erfordern besondere Sorgfalt beim Brandschutz.
Im Notfall muss eine Räumung schnell, geordnet und ohne Panik möglich sein. Gleichzeitig sollen Schulen offene, inspirierende Räume bieten – ein vermeintlicher Widerspruch. Doch genau hier zeigt sich: Guter Brandschutz ist kein Hindernis, sondern ermöglicht sichere Gestaltungsspielräume, wenn er frühzeitig mitgedacht wird.
2. Was gehört zum Brandschutz im Schulbau?
Der Brandschutz setzt sich aus vier ineinandergreifenden Bereichen zusammen:
- Baulicher Brandschutz: Brandabschnitte, feuerhemmende Materialien, Abschottungen, ausreichend dimensionierte Fluchtwege.
- Anlagentechnischer Brandschutz: Rauchmelder, Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Rauch- und Wärmeabzugssysteme.
- Organisatorischer Brandschutz: Räumungskonzepte, Alarmpläne, regelmäßige Übungen mit Schüler*innen und Personal.
- Abwehrender Brandschutz: Zugänglichkeit für Feuerwehr, Aufstellflächen, Löschwasserversorgung.
Grundlage sind die jeweiligen Landesbauordnungen sowie die Muster-Schulbau-Richtlinie (MSchulbauR). Schulbauten gelten als Sonderbauten – ihre Planung erfordert daher ein eigenständiges Brandschutzkonzept, das bereits in der frühen Planungsphase abgestimmt werden sollte.
3. Anforderungen bei Neubau, Sanierung und Umnutzung
Je nach Größe, Nutzung und Konzept gelten unterschiedliche Anforderungen. Zu den zentralen Punkten gehören:
- Flucht- und Rettungswege: Zwei unabhängige, gut sichtbare und barrierefreie Wege sind vorgeschrieben – auch bei offenen Raumkonzepten.
- Rauch- und Wärmeabzug: Systeme müssen Rauch aus Fluchtbereichen fernhalten. In größeren Schulen sind automatische Anlagen Pflicht.
- Materialwahl: Baustoffe und Oberflächen müssen den Brandschutzanforderungen genügen – auch Möbel und Einbauten.
- Technik und Sanierung: Nachrüstungen wie Dämmungen oder neue Technik (z. B. Photovoltaik, digitale Boards) verändern das Brandverhalten eines Gebäudes.
- Nutzungsänderungen: Wenn Räume umgewidmet werden, etwa zu Küchen, Ganztagsflächen oder Werkstätten, muss das Brandschutzkonzept angepasst werden.
4. Offene Lernräume und Brandschutz – ein Spannungsfeld mit Lösungen
Cluster, Lernlandschaften, gläserne Wände: Neue Schularchitektur will Offenheit und Transparenz ermöglichen. Doch offene Raumstrukturen stoßen oft an normative Grenzen – etwa bei der Bildung von Brandabschnitten oder der Führung von Fluchtwegen.
Typische Herausforderungen:
- Offene Lernbereiche ohne Türen lassen sich schwer in Brandabschnitte unterteilen.
- Glastrennwände sind gestalterisch beliebt, müssen aber speziellen Brandschutzanforderungen (z. B. EI30) genügen.
- Cluster mit innenliegenden Gemeinschaftsflächen benötigen durchdachte Entfluchtungskonzepte.
Was hilft:
- Frühzeitige Einbindung von Brandschutzexpert*innen – am besten ab der Phase Null.
- Simulation und Variantenprüfung – wie funktioniert ein Rückbau im Ernstfall?
- Konstruktiver Dialog zwischen Architektur und Pädagogik – kreative Lösungen entstehen oft im Austausch.
5. Wer gehört an den Tisch? Zusammenarbeit statt Zuständigkeit
Brandschutz ist Teamarbeit. Erfolgreiche Konzepte entstehen nur, wenn alle Beteiligten ihre Perspektiven einbringen – von der Bauaufsicht bis zur Schülervertretung:
- Schulträger: zuständig für die Einhaltung der Vorschriften und Beauftragung der Planenden.
- Architektinnen und Fachplanerinnen: entwickeln bauliche und technische Lösungen im Zusammenspiel mit Raumkonzepten.
- Brandschutzgutachter*innen: erstellen das Brandschutzkonzept, stimmen sich mit Behörden ab.
- Pädagogisches Personal: bringt wichtige Alltagskenntnisse ein, insbesondere bei Evakuierungsabläufen.
- Nutzervertretungen: können auf besondere Bedarfe, z. B. von Schüler*innen mit Mobilitätseinschränkungen, hinweisen.
Ein abgestimmtes Miteinander reduziert nicht nur Risiken – es erhöht auch die Akzeptanz der Maßnahmen und vermeidet kostspielige Nachbesserungen.
6. Fazit: Sicherheit ist mehr als Vorschrift – sie ist Voraussetzung für gute Schulen
Brandschutz ist kein formaler Pflichtpunkt auf der Checkliste. Er ist Teil einer verantwortungsvollen Planungskultur. Wer Schulen baut, muss nicht nur an Räume, sondern an Szenarien denken. Gute Lösungen entstehen, wenn technische Anforderungen und pädagogische Konzepte gemeinsam gedacht werden.
Wenn alle Beteiligten frühzeitig an einen Tisch kommen, entstehen Schulen, die sicher sind – und gleichzeitig offen, flexibel und zukunftsfähig. Brandschutz wird so nicht zur Einschränkung, sondern zur Grundlage für gute Bildungsarchitektur.
Checkliste für Schulträger: Das sollte auf dem Radar sein
✅ Brandschutzplanung von Anfang an integrieren
✅ Regelmäßige Abstimmungen mit Feuerwehr und Bauaufsicht
✅ Auch temporäre Lösungen (z. B. Containerklassen) berücksichtigen
✅ Pädagogisches Personal für Ernstfall sensibilisieren und schulen
✅ Nutzungsänderungen konsequent nach Brandschutzrecht bewerten
Als Schulbauberaterin begleite ich Schulträger und Planungsteams dabei, komplexe Themen wie den Brandschutz frühzeitig und praxisnah in die Schulbauplanung zu integrieren. Wenn Sie Fragen haben:
📧 kontakt@heikebrauer.com




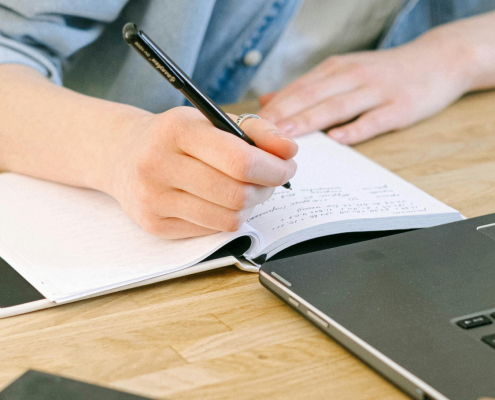 © pexels – Ivan Samkov
© pexels – Ivan Samkov